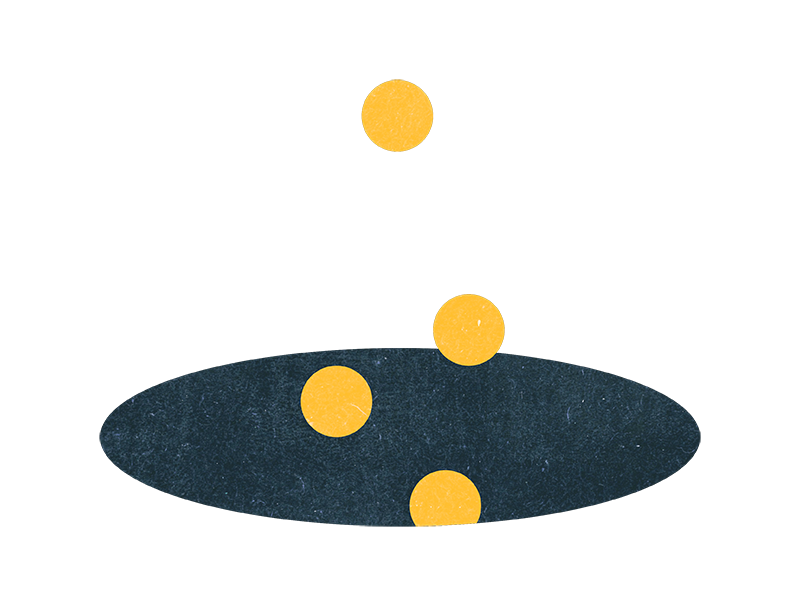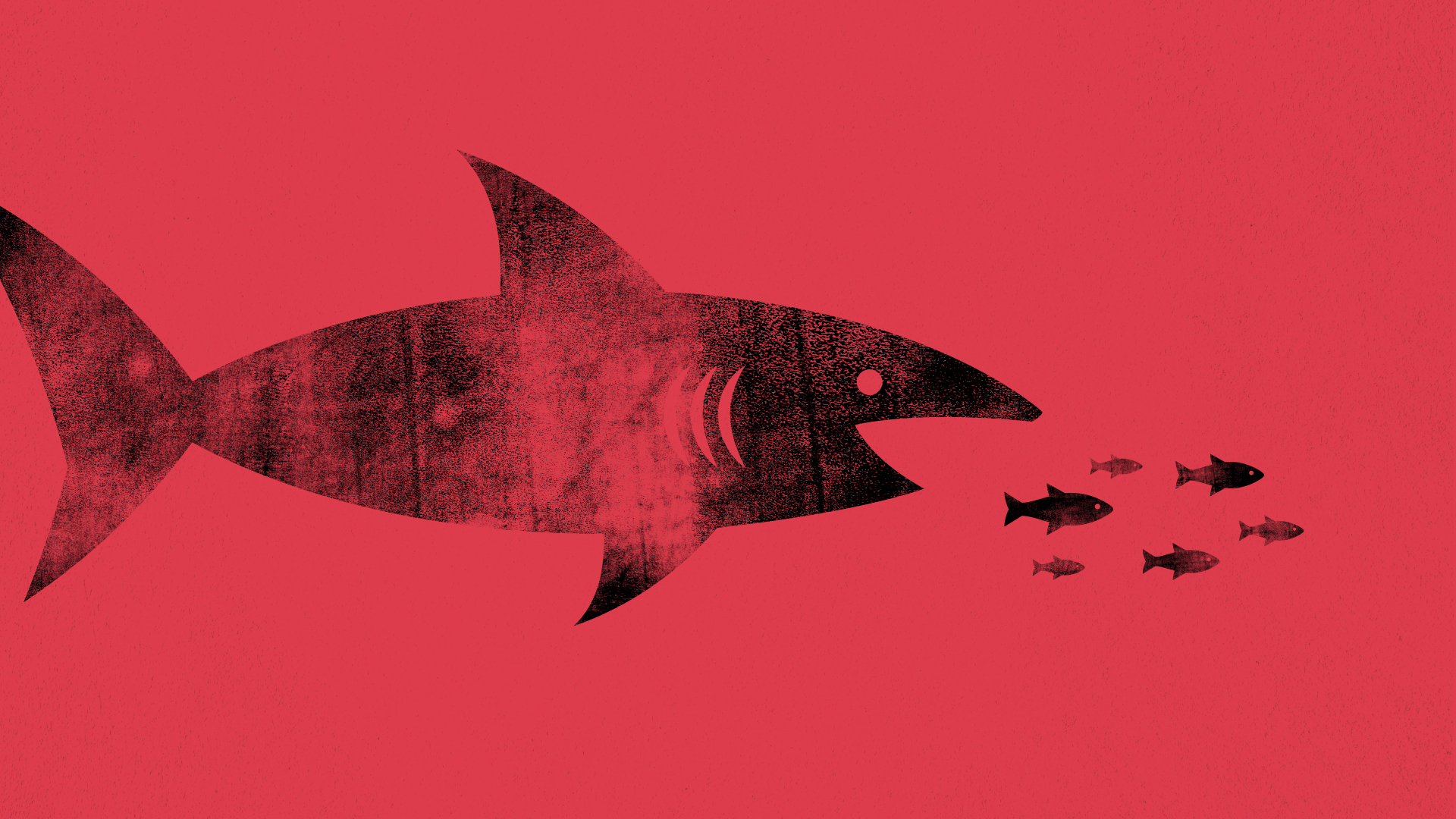Arm sein ist teuer
Über das Urteilen hinausdenken
Mit der alten Weisheit „Ihr habt allezeit Arme bei euch“ war nicht gemeint, wir sollten die Existenz von Armut akzeptieren, sondern dass es unsere Pflicht ist, uns umeinander zu kümmern.
Im November 2023 starb Charlie Munger, stellvertretender Vorsitzender des multinationalen Konglomerats Berkshire Hathaway und Warren Buffets langjähriger Freund und Geschäftspartner, im Alter von 99 Jahren. Er wurde für seinen Witz, seine Wohltätigkeit und sein Investmentwissen geachtet; laut der Londoner Financial Times hatte er dazu beigetragen, Berkshire zu einem „Investment-Powerhouse“ zu machen. Bei der Jahrestagung der Daily Journal Corporation von 2021 spielte Munger Sorgen um ein Ansteigen der wirtschaftlichen Ungleichheit durch die Fiskalpolitik der USA neckisch herab: „Ungleichheit ist absolut eine unvermeidbare Folge, wenn man eine Politik hat, durch die ein Volk reicher und reicher wird und die Armen aufsteigen. Ein bisschen Ungleichheit stört mich deshalb nicht.“
Deutlicher war Munger in einem Interview von 2019. Auf eine Frage nach politischen Bedenken zum Thema Ungleichheit lautete seine Antwort: „Die Leute, die deswegen schreien, sind Idioten. Das wird von selbst weggehen.“
Aber die Ungleichheit ist nicht weggegangen.
Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz schreibt in seinem Buch The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future: „Das oberste eine Prozent hat die besten Häuser, die beste Bildung, die besten Ärzte, den besten Lebensstandard, aber eines war für Geld offenbar nicht zu haben: die Erkenntnis, dass ihr Wohlergehen damit zusammenhängt, wie die anderen 99 % leben.“
Die Zahlen sind atemberaubend. Rund 3.300 Milliardäre weltweit besitzen Vermögen in Höhe von über zwölf Milliarden US-Dollar, während die halbe Weltbevölkerung von weniger als 6,85 US-Dollar am Tag lebt. Für rund 700 Millionen von ihnen bedeutet extreme Armut einen Kampf ums Überleben von unter 2,15 US-Dollar am Tag. Die reichsten 10 % haben über drei Viertel des weltweiten Vermögens. Laut dem Economic Policy Institute verdienten Firmenchefs 1965 „21-mal so viel wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer“. Diese Schere ist seither noch weiter auseinandergegangen: „2022 verdienten sie 344-mal so viel.“ Die sich selbst überlassene Ungleichheit ist nicht nur nicht weggegangen, sie hat zugenommen.
„Hier ist eine erschütternde Tatsache für euch: Wenn die zehn reichsten Männer der Welt 99,999 % ihres Vermögens verlören, wären sie immer noch reicher als 99 % der Weltbevölkerung.“
Das sind krasse statistische Zahlen, die über „ein bisschen Ungleichheit“ hinausgehen. Sie offenbaren strukturelle Praktiken, die in unsere Wirtschaft, Politik und Kultur eingewebt sind. Systemische Ungleichheit wirkt durch Politiken und Praktiken, die für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Ergebnisse zur Folge haben.
Über Jahrzehnte konnte die extreme Armut verringert werden, aber seit 2014 ist der Erfolg langsamer geworden, insbesondere nach der Coronapandemie. Die UNO hat ambitionierte Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt, um alle Formen von Armut zu beenden und die Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern bis 2030 zu verringern, aber noch immer sind Milliarden von Menschen in Armut gefangen.
Hinter diesen Zahlen stehen enorme Unterschiede in der Lebenserfahrung und Lebensqualität der Menschen. Die Wohlhabenden gewinnen weiter an Einfluss, Chancen und Kontrolle; die Armen sind mit immer mehr Barrieren konfrontiert, die schlechtere Gesundheit, geringere Bildung und verminderte wirtschaftliche Aussichten zur Folge haben.
Auf diese Realität verweist der US-Senator Bernie Sanders in seinem Vorwort zu dem Oxfam-Bericht Inequality Inc. von 2024: „Milliardäre werden reicher, die Arbeiterschaft hat zu kämpfen, und die Armen leben in Verzweiflung. Das ist der beklagenswerte Zustand der Weltwirtschaft.“ Diese Disparität hat einen Zyklus geschaffen, in dem Menschen mit den entsprechenden finanziellen Ressourcen in die Zukunft ihrer Familien investieren können, während die, die nicht darüber verfügen, zu kämpfen haben, um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen – von Vermögensbildung ganz zu schweigen.
Warum gibt es so viel Armut? Die UNO erklärt, das Problem „hat viele Dimensionen, aber zu seinen Ursachen zählen Arbeitslosigkeit, soziale Exklusion und hohe Vulnerabilität bestimmter Bevölkerungen durch Katastrophen, Krankheiten und andere Phänomene, die sie daran hindern, produktiv zu sein“.
Die Auswirkungen der weitverbreiteten Ungleichheit und Armut können über individuelle Not hinausgehen; sie können den gesamtwirtschaftlichen Fortschritt hemmen und Gemeinwesen schwächen. Wenn große Teile der Bevölkerung nicht vollständig an der Wirtschaft teilhaben können, ist ihr nicht genutztes Potenzial ein Verlust für alle. Eingeschränkter Zugang zu qualitätvoller Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftlichen Chancen hindert Menschen an der Entwicklung ihrer potenziellen Talente, und das kann die Gesellschaft als Ganzes schwächen.
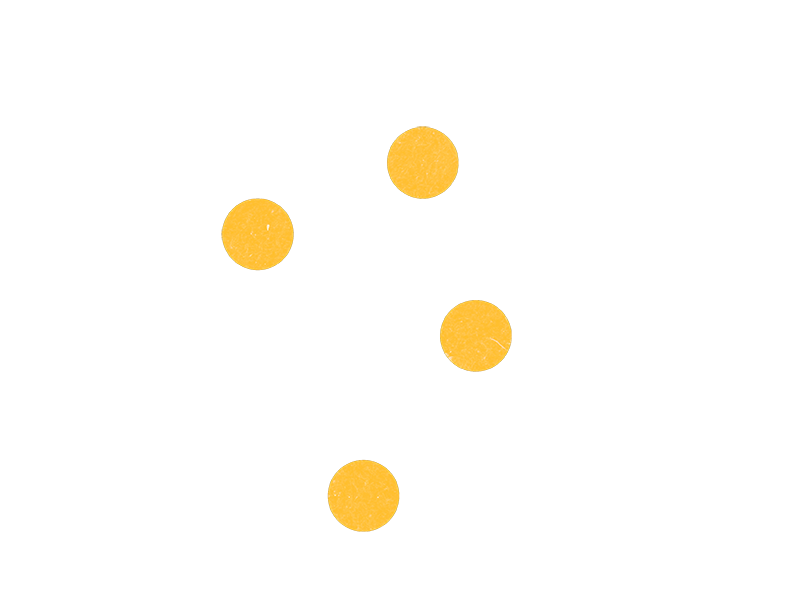
Als Armut ein moralischer Defekt wurde
Was sind die Überzeugungen und Einstellungen, die diese Ungleichheiten bestehen lassen? Seit Menschengedenken bestimmt die Art einer Gesellschaft, ihre Armen zu sehen, den Umgang mit ihnen. Manche sahen Armut als moralischen Defekt, andere als Schicksal oder Bestimmung und noch andere als Folge von Ungerechtigkeit oder endemischen sozialen Problemen. Armen zu helfen, ist Bestandteil mancher Kulturen; viele sehen es als moralische Verpflichtung und als Mittel, Gott näher zu kommen. Den alten Israeliten wurde gesagt: „Es werden allezeit Arme sein im Lande“ (5. Mose 15, 11). Was dieser Aussage folgt, legt nahe, dass sie diese Tatsache nicht einfach akzeptieren sollten; sie sollte sie vielmehr zu persönlicher Großzügigkeit bewegen.
„Es werden allezeit Arme sein im Lande; darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande.“
Eine kognitive Voreingenommenheit, die bestimmt, was viele Menschen heute über Armut denken, ist die Hypothese, die Welt sei gerecht. Diesem weitgehend unbewussten Glauben zufolge bekommt jeder im Leben, was er verdient – die Welt sei im Grunde fair, und Erfolg wie Misserfolg seien verdient. Das führt zu der oben erwähnten Ansicht, dass die Armen etwas getan haben müssen, um ihre Lage zu verdienen, sei es durch fehlendes Bemühen, schlechte Entscheidungen oder moralisches Versagen. Statt anzuerkennen, dass das System selbst fehlerhaft sein könnte, wird die Schuld bei denen gesehen, die darin gefangen sind.
Verwandt mit diesem Denken ist die individualistische Vorstellung, „sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen“. Laut Alissa Quart in Bootstrapped: Liberating Ourselves From the American Dream beruht der „Irrglaube der Gesellschaft“, man komme ganz auf sich allein gestellt zum Erfolg, „auf einer Vorstellung von persönlicher Verantwortung sowie einer Vorstellung, dass die Reichen ihre Reichtümer verdienen“. Das bedeutet auf der anderen Seite: „Die Armen und die knapp auskommende Mittelschicht verdienen es, am Rand zu leben. […] Der Münchhausen-Mythos schiebt die Schuld der Ungleichheit uns in die Schuhe, und unsere fehlerhaften Systeme kommen ungeschoren davon.“
„Sich eigenständig aus dem Sumpf zu ziehen“, so Quart, „bedeutet in Wahrheit, die Rolle unserer Eltern, Lehrer oder Betreuer sowie die Rolle von Wohlstand, Geschlecht, Rasse, ererbtem Vermögen und einem ganzen Hort damit verbundener Chancen zu ignorieren oder zu löschen.“
Ein Paradebeispiel für diese falschen Vorstellungen von Armut sind die englischen Armengesetze des 16. bis 19. Jahrhunderts. Die Obrigkeit unterteilte Bedürftige in zwei Kategorien: Die „würdigen“ (Alte, Kranke oder Behinderte) erhielten Unterstützung und die „unwürdigen“ (arbeitsfähig, aber arbeitslos) konnten nur Unterstützung bekommen, wenn sie ihr Zuhause verließen, um in Arbeitshäusern zu leben. Diese Politik spiegelte die Überzeugung wider, dass Armut eine Folge persönlicher Verfehlungen sei. Die Bedingungen in den Arbeitshäusern waren hart und unerfreulich, sodass sich nur wirklich Verzweifelte bewarben. Der Historiker Mark Neuman schreibt in Victorian Britain, dass das Arbeitshaus als Institution „ein abschreckendes Mittel sein sollte, das Arbeitsscheue zu ehrlicher, harter Arbeit treiben würde“.
Als zu Beginn des 20. Jahrhundert Sozialwissenschaften aufkamen, versuchten Forscher, Armut anhand kultureller und psychischer Rahmenbedingungen zu erklären. In den 1960er-Jahren entwickelte der US-Anthropologe Oscar Lewis seine Theorie einer „Kultur der Armut“, der zufolge Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, Verhaltensweisen und Werte entwickeln, die sie arm bleiben lassen und die an nachfolgende Generationen weitergegeben werden. Jüngere Untersuchungen der systemischen und sozialen Faktoren, die zu Armut beitragen, haben diese Theorie widerlegt; aber bei denen, die die Schuld für Armut bei den Armen selbst sehen, kommt sie noch immer an.
„Wenn wir glauben, allerdings fälschlicherweise, dass arme Menschen keinen Wert auf Bildung legen, dann weichen wir der Verantwortung aus, die eklatanten Ungleichheiten in der Bildung zu beseitigen, mit denen sie zu kämpfen haben.“
Das viktorianische Arbeitshaus ist ein Relikt, aber die Moralphilosophie, die dahinterstand, bestimmt noch immer die moderne Sozialpolitik. Die aktuellen amerikanischen Diskussionen um Arbeitspflicht für Sozialleistungen, Drogentests für Leistungsempfänger und die angebliche „Kultur der Armut“ sind ein Ausdruck jener historischen Vorurteile über die tieferen Ursachen von Armut. Diese anhaltenden Sichtweisen maskieren eine entscheidende Realität: Die Faktoren, die wirtschaftliche Ungleichheit schaffen und aufrechterhalten, sind heute weit komplexer und schwerer zu überwinden. Um Armut heute zu verstehen, muss man über Denkgewohnheiten über persönliche Verantwortung hinausschauen und die Herausforderungen, mit denen Menschen in ihrem täglichen Leben konfrontiert sind, aufrichtig prüfen.
In der Systemfalle
Benachteiligte Menschen sind in fast jedem Aspekt des Lebens mit Hindernissen‘ konfrontiert. Schon der Versuch, ein Bankkonto, eine Wohnung oder einen Arzttermin zu bekommen, kann bedeuten, einen Wust von Papieren und steigende Gebühren zu bewältigen. Für Familien, die von einem Zahltag zum anderen leben, kann ein Ärgernis wie eine erhöhte Versicherungsprämie oder Kontoführungsgebühr oder eine Reifenpanne über einen Dominoeffekt in eine Krise führen.
In den USA haben die Regierungen des Lands und der Bundesstaaten im Jahr 2023 mehr als eine Billion Dollar für Programme zur Armutsbekämpfung ausgegeben. Allerdings geht das Geld für solche Programme nicht direkt an die Bedürftigen. Stattdessen beauftragt die Regierung oft Vertragsfirmen des privaten Sektors mit der Bereitstellung wichtiger Leistungen. Anne Kim gibt diesen Wirtschaftszweigen in ihrem Buch Poverty for Profit: How Corporations Get Rich Off America’s Poor den Beinamen „Poverty Inc.“ [etwa „Armut GmbH“]. Sie sind eine „riesige Sammlung von Wirtschaftszweigen, die von den Armen leben“. Und Kim erläutert: „Die Infrastruktur der Armut ist Big Business. Und als solche ist sie ein wesentlicher Bestandteil der systemischen Barrieren, mit denen einkommensschwache Amerikaner konfrontiert sind.“
Der Bankensektor liefert ein Beispiel dafür, wie dieses System funktioniert. In „Banking and Poverty: Why the Poor Turn to Alternative Financial Services“ schreiben die Autoren des Berkeley Economic Review, dass es für Banken „einfach nicht profitabel“ ist, Haushalten mit mittleren und niedrigen Einkommen Leistungen zu bieten. Diesem Risiko für ihre Profitabilität begegnen Banken, indem sie für jede Leistung, die sie bieten, Gebühren erheben. Deshalb können es sich viele Haushalte mit geringem Einkommen nicht leisten, herkömmliche Banken in Anspruch zu nehmen. Dies zwingt sie, um sich zum Beispiel Schecks auszahlen zu lassen, Alternativen zu nutzen, die scheinbar weniger kosten, aber tatsächlich ihren eigenen schwindelerregend hohen Preis haben. Wenn ein Notfall eintritt (und sei es nur ein platter Reifen), können „Payday Loans“ – Überbrückungsdarlehen auf künftige Lohnzahlungen – als Rettungsanker erscheinen, aber zu vernichtenden Jahreszinssätzen von 300 bis 600 %, wenn man sie nicht fast umgehend zurückzahlen kann.
Dieses Muster wiederholt sich weltweit. Eine schnelle Internetsuche ergibt, dass sogenannte Kredithaie nicht nur in den USA operieren, sondern auch in Großbritannien, Kanada, Australien, der EU und vielen anderen scheinbar entwickelten Ländern. In Kambodscha, Jordanien, Mexiko und Sri Lanka haben solche Beutemacher inzwischen die persönliche Finanzbranche auf den Kopf gestellt. Infolge des schwachen Verbraucherschutzes sind Kreditnehmer aggressiven Bedrohungen ausgeliefert; manche werden gezwungen, ihr Haus und ihr Land zu verkaufen. Gefangen in einem Strudel immer tieferer Verschuldung haben sich andere wegen der Hoffungslosigkeit ihrer Lage das Leben genommen.
„Jeder, der einmal mit Armut zu kämpfen hatte, weiß, wie extrem teuer es ist, arm zu sein.“
Neben räuberischen Finanzpraktiken ist auch die Unsicherheit der Wohnsituation eine zentrale Dimension der Armut. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird in aller Welt immer schwieriger; Preistreiber sind zu starke Nachfrage, Bebauungsvorschriften und hohe Kosten, aber auch Widerstand von Ansässigen gegen unerwünschte neue Nachbarn. Ein weiterer Faktor ist auch schlichte Geldgier. Wie Liz Zelnik von Accountable.US schreibt, haben „große Immobilienkonzerne die Mieten für normale Familien immer weiter angehoben – gleichgültig, wie hoch ihre Gewinne geworden sind“.
Steigende Mieten zwingen die Menschen zu schweren Entscheidungen zwischen der Bezahlung ihrer Miete und anderer Grundbedürfnisse. Das US-Ministerium für Wohnungsbau und städtische Entwicklung bietet zwar Wohngeld an, räumt aber im Wohngeldbericht von 2024 ein, dass das Programm unterfinanziert ist und nur „etwa eine von vier berechtigten Familien“ erreichen kann. Selbst wenn Wohngeld verfügbar wird, können bezahlbare Optionen mit verdeckten Kosten verbunden sein: unsichere Wohngegenden, veraltete Infrastruktur und mangelhafte Heizung, Stromversorgung oder Sanitäranlagen. Laut einer Schätzung der UNO leben weltweit über 1,8 Milliarden Menschen in Substandard-Wohnraum, und mindestens 150 Millionen haben gar keinen Wohnraum.
Für die Wohnungslosen sind die Herausforderungen noch größer. Sie werden eher Opfer von Gewalt, Misshandlungen und Beleidigungen sowie psychischen und körperlichen Krankheiten. Das Fehlen einer festen Adresse kann es komplizierter machen, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten, wichtige Dokumente zu empfangen oder Zugang zu notwendigen Leistungen wie medizinischer Versorgung, Nahrungsmittelhilfe und Wohngeld zu haben. Am erschreckendsten ist vielleicht, dass 40 bis 60 % der Wohnungslosen in den USA einen Arbeitsplatz haben, aber einfach nicht genug für die hohen Mietpreise in der Nähe ihres Arbeitsplatzes verdienen. Darüber hinaus sind Wohnungslose „immer Zielscheibe der Kriminalisierung“, so Peter Edelman in Not a Crime to Be Poor: The Criminalization of Poverty in America. Zwar haben unterschwellige Vorurteile Gesellschaften ohnehin oft dazu geführt, Wohnungslose zu bestrafen, erklärt er, aber „jetzt führen Kommunalverwaltungen wegen der Knappheit von Mitteln für Wohnraum, die Versorgung psychisch Kranker, die Behandlung von Drogen- und Alkoholsucht sowie Basis-Geldleistungen noch schärfere Strafmaßnahmen durch“.
Unzureichende medizinische Versorgung verstärkt diese Schwierigkeiten weiter. Aufgrund hoher Kosten, fehlender Versicherung und der begrenzten Zahl von Anbietern in unterversorgten Gebieten haben viele Menschen keinen Zugang zu dringend nötigen medizinischen Eingriffen, von Vorsorge ganz zu schweigen. Selbst mit Versicherung können hohe Selbstbehalte und Eigenanteile medizinische Leistungen unbezahlbar machen. Ein einziger medizinischer Notfall kann die Ersparnisse eines ganzen Lebens vernichten oder Familien in den Ruin stürzen. Chronische Gesundheitsprobleme, unbehandelte psychische Störungen und Behinderungen verstärken die Schwierigkeiten derer, die in Armut leben.
Eine weitere beunruhigende Dimension dieser Schwierigkeiten ist die Kriminalisierung von Armut. Edelman erläutert, dass das Justizsystem oft ein Zweiklassensystem ist. „Menschen mit niedrigen Einkommen werden wegen geringfügiger Verstöße festgenommen, die für Leute mit Geld nur lästig sind, für die Armen und nahezu Armen aber katastrophal wegen der hohen Bußgelder und Gebühren, die wir nun fast routinemäßig erheben. Arme müssen in Haft auf ihren Prozess warten, wenn sie keine Sicherheitsleistung erbringen können, bekommen überzogene Geldstrafen und werden mit stetig steigenden Kosten und Gebühren geschlagen. Wer nicht zahlt, bekommt mehr Zeit in Haft, mehr Schulden durch kumulierte Zinsen, zusätzliche Geldstrafen und Gebühren und – eine häufige Strafe mit erheblichen Konsequenzen für Menschen, die unterhalb oder nahe der Armutsgrenze leben – wiederholten Entzug der Fahrerlaubnis. Arme Menschen verlieren ihre Freiheit und oft auch ihre Arbeit, sind oft von einer Vielzahl öffentlicher Leistungen ausgeschlossen [und] können das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren.“
„Mit Fiktionen von Reichen, es aus eigener Kraft geschafft zu haben oder mehr wert zu sein, vertuschen die Megareichen ihre Abhängigkeiten und geben gleichzeitig normalen Menschen die Schuld dafür, dass sie Unterstützung brauchen.“
Diese Herausforderungen treffen bestimmte Gruppen besonders hart. Minderheiten anderer Hautfarbe sind mit zusätzlichen Barrieren konfrontiert, darunter schlechterer Bezahlung, Gettoisierung und mehr Polizeikontakten und Festnahmen. Frauen, vor allem alleinerziehende Mütter, jonglieren mit den Anforderungen der Kinderbetreuung bei schlecht bezahlten, instabilen Arbeitsverhältnissen. Immigranten haben zusätzlich spezifische Schwierigkeiten wie Sprachbarrieren, einen prekären Rechtsstatus und Ausbeutung am Arbeitsplatz. Wenn mehrere Barrieren zusammenkommen, wird es extrem schwer, sich aus der Armut herauszuarbeiten.
Die Folge? Ein Teufelskreis, in dem jedes Problem die anderen verschlimmert. Aus ihm auszubrechen, erfordert nicht allein außerordentliche Anstrengungen von den Betroffenen, sondern auch Veränderungen an den zugrunde liegenden Systemen, die diese Barrieren schaffen und aufrechterhalten.
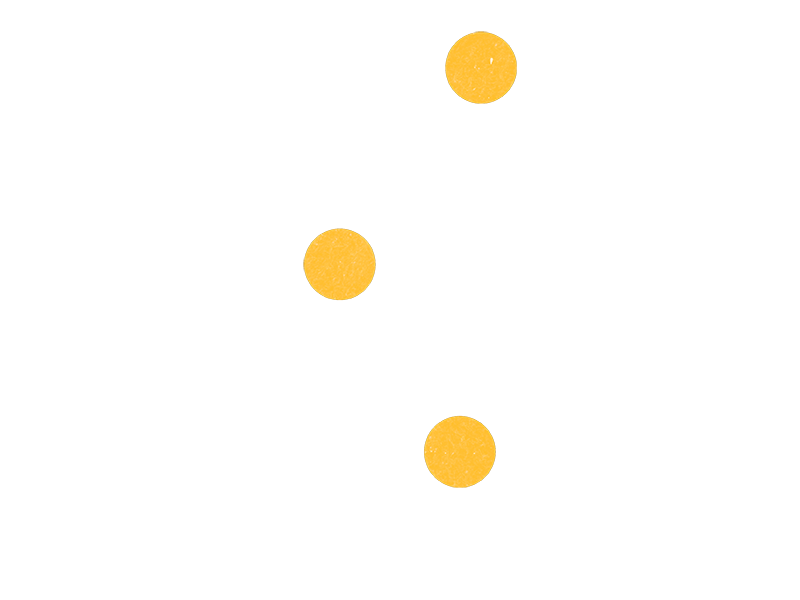
Ausweg aus dem Teufelskreis: Systeme und Lösungen
Bei der Suche nach Lösungen für die Beendigung des Teufelskreises Armut ist eines klar: Ungleichheit gibt es in fast jedem Land, in jedem Wirtschaftssystem. Marktwirtschaften generieren oft enormen Wohlstand für wenige und lassen viele in bitterer Armut. Verteidiger der Marktwirtschaft loben ihre Effizienz, Produktivität und Innovation, aber Kritiker weisen darauf hin, dass Kapitalismus Wohlstand in den Händen weniger konzentriert, während die Armen die Kosten tragen.
Auch sozialistische und gemischte Volkswirtschaften haben die Armut nicht eliminiert. Einige Länder haben extreme Armut durch Sozialprogramme gemindert, aber damit ist nicht alles gelöst. Nordische Länder, oft als Vorbilder des demokratischen Sozialismus angeführt, haben noch immer mit armen Randgruppen zu tun, insbesondere Immigranten. Chinas dramatisches Wirtschaftswachstum hat Millionen aus der Armut herausgeholfen, aber es besteht noch ein erhebliches Gefälle zwischen Bewohnern ländlicher und städtischer Gebiete. Und trotz einer Verringerung der Armut ist die Kluft der Ungleichheit zwischen diesen Bevölkerungsgruppen tatsächlich größer geworden.
Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty behauptet: „Das derzeitige Wirtschaftssystem funktioniert nicht, wenn es darum geht, das zentrale Problem zu lösen, das wir lösen müssen – das Problem zunehmender Ungleichheit.“ Was bei allen Systemen klar wird, ist, dass das Fortdauern von Armut eine Folge politischer Entscheidungen und Machtstrukturen ist. Ob in Marktwirtschaften, sozialistischen Volkswirtschaften oder Mischformen – die Reichen und Einflussreichen gestalten die Regeln und Institutionen so, dass ihre Vorteile gewahrt werden.
Die Frage ist nicht, ob ein bestimmtes Wirtschaftssystem Armut schafft, sondern ob überhaupt ein System so strukturiert werden kann, dass es gerechtere Ergebnisse für alle Mitglieder der Gesellschaft bewirkt, wenn falsche Vorstellungen von Armut uns blind dafür machen, was ihr wahres Wesen ist.
„Armut ist nicht einfach Mangel an Einkommen. Sie ist Mangel an Bildung, Ernährung, medizinischer Versorgung, Obdach, politischer Inklusion, Wahlfreiheit, Sicherheit, Würde.“
Wenn man die Situation von Menschen beurteilt, bevor man ihre Bedürfnisse verstanden hat, riskiert man, die Systeme zu perpetuieren, die von ihren Beschwernissen profitieren.
Doch wenn man von den Auswirkungen der Armut nicht persönlich berührt ist, warum sollte man sich kümmern? Die UNO gibt eine Antwort: „Als Menschen ist unser Wohlergehen miteinander verbunden. Wachsende Ungleichheit ist schädlich für das Wirtschaftswachstum und untergräbt den sozialen Zusammenhalt, verstärkt politische und soziale Spannungen und ist unter bestimmten Bedingungen eine treibende Kraft für Instabilität und Konflikte.“
Angesichts dessen kann man schließen, dass mit der alten Weisheit – „Ihr habt allezeit Arme bei euch“ – nicht gemeint war, man solle sich mit der Unabwendbarkeit von Armut abfinden. Sie erinnert vielmehr an unsere bleibende Pflicht, uns umeinander zu kümmern. Doch die heutigen Reaktionen auf die Armen spiegeln oft die gleichen urteilenden Haltungen wider, die einst die viktorianischen Arbeitshäuser hervorbrachten. Wir neigen noch immer dazu, Menschen in die Schubladen „würdig“ und „unwürdig“ zu stecken und die komplexen Systeme zu ignorieren, die Armut schaffen und aufrechterhalten.
Lösungen für Ungleichheit und Armut sind möglich, aber sie erfordern sowohl systemischen als auch persönlichen Wandel. Politische Reformen sind unverzichtbar, aber ohne einen Wandel unserer Sicht auf die Armen können diese Veränderungen nicht geschehen.
Das alte Gebot, „dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist“, spricht von persönlicher Wohltätigkeit. Für unsere Zeit impliziert das: Wenn wir die Zwangslage der Armen verbessern wollen, bedarf es unbedingt eines grundlegenden Wandels in unserer Art, unsere Gemeinschaften und Wirtschaftssysteme zu strukturieren, mit Fairness als Ziel. Der Erfolg einer Gesellschaft sollte auch daran gemessen werden, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht.
Letztlich müssen wir, um der Armut zu begegnen, über das urteilende Denken hinausgehen. Wir dürfen die Armen nicht als Probleme sehen, die es zu lösen gilt, als moralische Objekte, die wir zu beurteilen haben, oder als Gelegenheiten, um Profit zu machen, sondern wir müssen sie als Mitmenschen betrachten, deren Würde und Potenzial für uns alle wichtig sind.