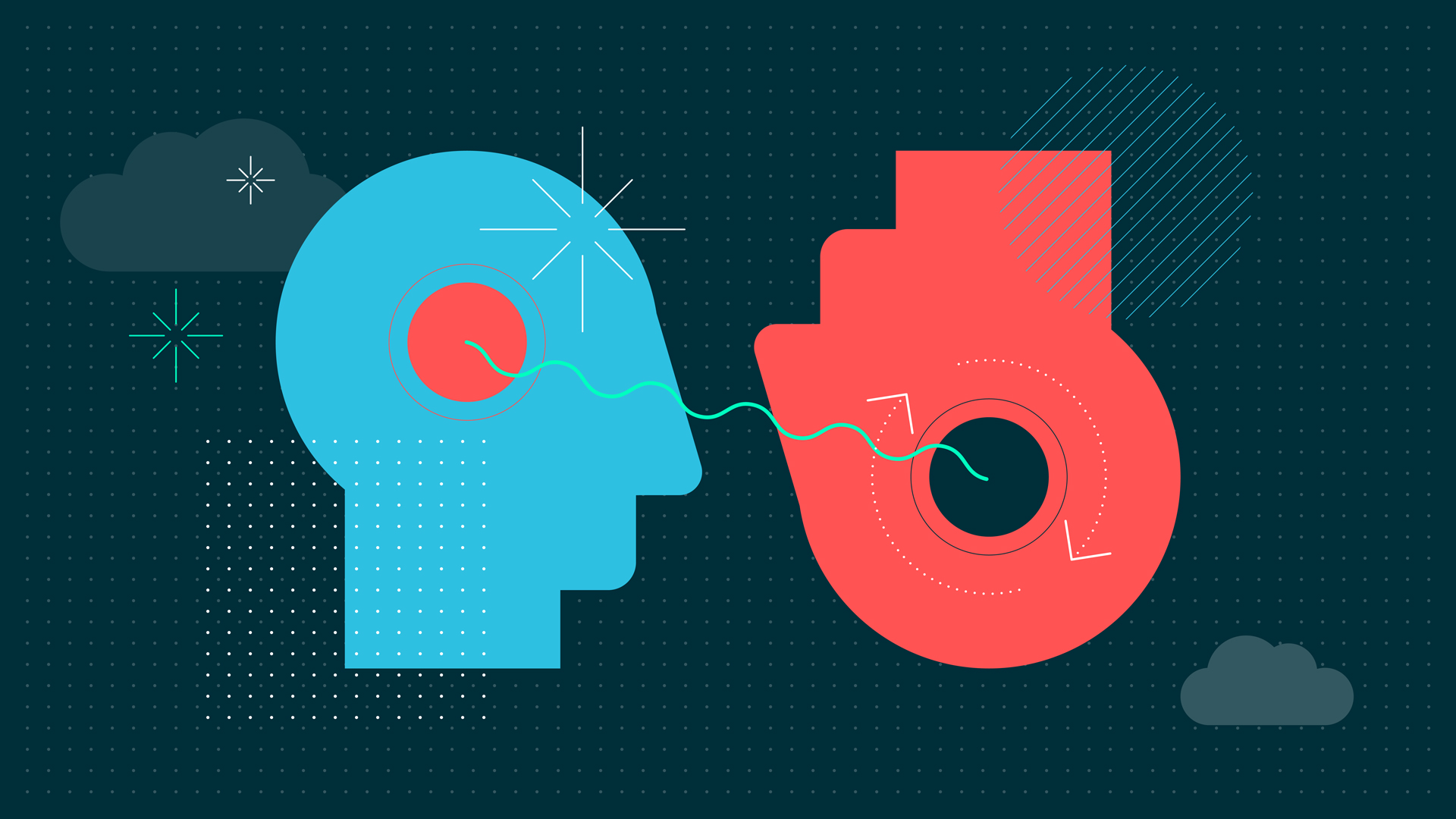Nachdenken über das Denken
Der Einfluss von Emotionen auf Entscheidungen
Seit Langem herrscht die Vorstellung, Gefühl und Logik seien unabhängig voneinander, aber um sicherzugehen, dass sie zu unserem Besten zusammenwirken, ist ein gewisser Aufwand nötig. Wie kann man die Gabe des Gefühls nutzen, um gut überlegte Entscheidungen zu treffen?
In den westlichen Kulturen ist es selten ein Kompliment, jemandem zu sagen, er habe „emotional entschieden“ oder er sei gar „ein emotionaler Mensch“. Wir sind darauf konditioniert, zu denken, gute Entscheidungsfindung bedeute, dass man alle Gefühle zugunsten des rein „rationalen“ Denkens aus der Gleichung heraushält – obwohl bekannt ist, dass das Gehirn nicht so funktioniert.
In Wahrheit sind alle Menschen emotional: Wir haben von Geburt an die Fähigkeit, zu fühlen, sofern nicht etwas Seltenes oder Traumatisches eintritt und das verhindert. Abgesehen von einem solchen Hinderungsgrund können wir aber nicht rational denken, ohne dass Emotionen im Spiel sind – und das sollte man auch nicht hoffen. Es stimmt, dass eine übermächtige Gefühlsregung stärker sein kann als die Fähigkeit zu Überlegung und Selbstbeherrschung, wenn man das zulässt; aber es stimmt nicht, dass Gefühle der Feind sind oder dass man nur mit dem Verstand allein gute Entscheidungen trifft.
Was ist dann gemeint, wenn von „emotionalen Entscheidungen“ die Rede ist?
Mit dieser Formulierung werden oft reflexartige Reaktionen beschrieben, angetrieben durch eine starke Gefühlsregung, die als negativ wahrgenommen wird, z. B. Zorn oder Empörung, oder eine Emotion, die eine subtile Voreingenommenheit aktiviert (oder von ihr aktiviert wird), wenn man nicht lange genug nachgedacht hat, um sie zu identifizieren. Ein rascher Blick in die Geschichte der Menschheit reicht aus, um eine breite Vielfalt tragischer Beispiele hierfür zu finden. Auf diese Weise sind ganze Völker dazu geführt worden, sich an der unmenschlichen Behandlung anderer Menschen zu beteiligen, und es ist ein immer wieder auftretendes Muster beim Aufstieg und Fall vieler Länder.
Charismatische Persönlichkeiten scheinen ihre Anhänger mühelos manipulieren zu können, einfach indem sie die normalen Voreingenommenheiten aktivieren, die wir alle haben. Und obgleich man erwarten könnte, dass unsere Emotionen der wichtigste Auslöser voreingenommenen Denkens sind, ist das nicht immer der Fall. Manchmal kann ein scheinbar rationales Argument ebenso effektiv zur Manipulation genutzt werden. Der gängige Irrglaube, die Gehirnfunktionen des Menschen seien so spezialisiert, dass man seine innere Welt zwischen sogenanntem rationalen Denken und Gefühl aufteilen könne, hat eine falsche Zweiteilung geschaffen. Wir sind nicht auf die Wahl zwischen Gefühl und Vernunftdenken beschränkt. Wie gesagt – eine solche Wahl gibt es gar nicht.
Da beide Aspekte in unserem Inneren zusammenwirken und beide von Voreingenommenheiten beeinflusst werden, ist es entscheidend, die Beziehung zwischen ihnen zu verstehen. In ihrem Zusammenwirken bilden diese beiden stark miteinander verbundenen Aspekte des menschlichen Innenlebens unsere Denkfähigkeit. Wenn wir dies nicht verstehen und nicht auf die Einflüsse achten, die uns in die Irre führen können, kann unsere Fähigkeit zu kritischem Denken von Leuten mit zweifelhaften Absichten gekapert werden – Leuten, die es im Gegensatz zu uns verstehen. So kann unser Denken zum Entgleisen gebracht werden.
Dies hängt nicht davon ab, wer wir sind. Oft wird gesagt, Männer seien nicht so emotional wie Frauen und daher logischer in ihrem Denken, aber dieser altbekannte Mythos ist leicht zu widerlegen. Wie viele gängige Mythen mag er für unser persönliches Leben wahr klingen, aber es erfordert sorgfältige Überlegung und kritisches Denken, zu verstehen, warum das nicht stimmt. Einige der ersten Studien zum Thema Emotion und Geschlecht beruhten auf eigenen Angaben der Probanden. Dabei wurde allerdings nicht berücksichtigt, dass Jungen von klein auf vermittelt wird, „ein Junge weint nicht“ und sie sollten „hart sein“, während es bei Mädchen eher akzeptiert ist, wenn sie Gefühle frei zum Ausdruck bringen. Dass Männer, die dazu erzogen wurden, ihre Gefühle zurückzuhalten, dann erkennen oder gar angeben, was sie fühlen, ist unwahrscheinlich.
Werden emotionale Unterschiede dagegen mit fMRI (funktionaler Magnetresonanztomografie) untersucht, sieht man bei Männern und Frauen die gleichen emotionalen Anfangsreaktionen auf Ereignisse, aber sie können sie etwas unterschiedlich regulieren. Generell scheinen Frauen negative Emotionen zu regulieren, indem sie sie mithilfe positiver Emotionen neu bewerten, während Männer negative Emotionen eher regulieren, indem sie sie überwachen und zügeln – was einleuchtet, wenn man bedenkt, dass sie wahrscheinlich von klein auf darin trainiert worden sind, auf diese Weise zu reagieren.
Zum Glück ist die volle Bandbreite menschlichen Empfindens nicht durch das Geschlecht begrenzt; mit Übung ist sie für uns alle verfügbar, und sie ist ein reiches Erbe. In ihrem Atlas of the Heart nennt die Psychologin Brené Brown 87 Emotionen, allerdings ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit ihrer Liste zu erheben. Was sie aber behauptet, ist dies: „Wenn wir nicht verstehen, wie unsere Gefühle unsere Gedanken und Entscheidungen formen, verlieren wir den Kontakt mit unseren eigenen Erfahrungen und miteinander. […] Zugang zu den richtigen Worten zu haben kann ganze Universen öffnen.“
„Ohne zu verstehen, wie Fühlen, Denken und Verhalten in uns zusammenwirken, ist es fast unmöglich, unseren Weg zu uns selbst und zueinander wiederzufinden.“
Das ist etwas Gutes, wenn es um alle Aspekte des Menschseins einschließlich des Entscheidens geht. Wir alle können die für Kreativität und Innovation so wichtige emotionale Intelligenz nutzen, um Lösungen für Probleme zu finden, die kritisches Denken erfordern. Wir alle sind fähig, sowohl die emotionale Bewusstheit als auch die Selbstkontrolle aufzubringen, die nötig ist, um sorgfältig auf die Voreingenommenheiten und Gefühlszustände zu achten, die unsere Entscheidungen beeinflussen können.
Und wie geht das?

Emotionale Trigger überdenken
Eine erhebliche Herausforderung für kritisches Nachdenken über unsere Entscheidungen betrifft unsere Reaktionen auf Wörter, Sätze oder Gedanken, die uns triggern. Das sind Begriffe oder Vorstellungen, die wie emotionale Fallstricke wirken, sobald wir sie hören – seien es politische Schlagworte, Ausdrücke mit unterschwelliger Bedeutung oder Gedanken, die mit unseren tiefen Überzeugungen in Konflikt zu stehen scheinen. Wenn wir solchen Triggern begegnen, kann das System in unserem Gehirn, das Reaktionen auf Gefahren steuert, eine empörte Reaktion auslösen, ehe wir Zeit haben, uns zu fragen, ob diese Emotion berechtigt ist oder eine andere (oder auch ein Gemisch aus Emotionen) angemessener sein könnte. Dieser automatische Prozess ist natürlich, wird aber zum Problem, wenn er uns daran hindert, einen produktiven Dialog zu führen oder komplexe Perspektiven in Betracht zu ziehen.
Althergebrachte Weisheit und moderne Erkenntnisse
Die althergebrachte Weisheitsliteratur der Bibel bietet eine überraschend nuancierte Sicht von Gefühl und Entscheidungsfindung. Der biblische Weisheitsbegriff umfasst sowohl emotionale als auch intellektuelle Facetten. So wurde Salomo, als er um Weisheit bat, „ein weises und verständiges Herz“ gegeben (1. Könige 3, 12). An anderer Stelle in der Bibel heißt es: „Des Weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre“ (Sprüche 16, 23).
Diese und ähnliche Beispiele zeigen eine sehr enge Verbindung zwischen Gefühl und Weisheit. Wie wahr diese ganzheitliche Sicht ist, zeigen neurowissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie Gefühl und Verstand – untrennbare Aspekte des Denkens – bei der Entscheidungsfindung zusammenwirken.
Daniel Kahnemans Arbeit über die Reduzierung von Rauschen und Voreingenommenheit bei der Urteilsbildung erinnert an althergebrachte Ermahnungen, gründlich nachzudenken, bevor man handelt: „Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist; aber der Mund der Gottlosen schäumt Böses“ (Sprüche 15, 28).
Bei den immer komplexeren Entscheidungen, die unsere moderne Welt uns abverlangt, kann es hilfreich sein, darauf zu achten, wo heutige Forschung und althergebrachte Weisheit übereinstimmen. Führende Mitglieder der Urkirche spornten die Anhänger Jesu an, ihr Wissen um den filigranen Tanz zwischen Gefühl und Verstand zu vertiefen, „dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei“ (Philipper 1, 9–10).
Dieser Auftrag ist heute ebenso gültig wie damals.
Das Gute ist, dass wir trainieren können, verstärkt auf emotionale Trigger zu achten, sodass sie uns nicht zu den falschen Annahmen führen; aber zuvor müssen wir willens sein, unsere Anfangsreaktionen zu hinterfragen. Um zu verstehen, wie wichtig es ist, innezuhalten und zu hinterfragen, ist es nützlich, ein wenig darüber zu verstehen, wie wir zu Schlussfolgerungen gelangen.
Daniel Kahneman (1934–2024) war ein israelisch-amerikanischer Psychologe und bekannt für seine Arbeit mit Amos Tversky über die Entscheidungsfindung. Tversky starb 1996, aber Kahneman erhielt 2002 für ihre gemeinsame Arbeit den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft. Sie entdeckten zwei Denkmodi, die sie einfach „System 1“ und „System 2“ nannten. Kahneman fasste in seinem Buch Thinking, Fast and Slow ihre Funktionen zusammen: „System 1 funktioniert automatisch und schnell, ohne oder mit wenig Aufwand und ohne ein Gefühl willentlicher Steuerung. System 2 investiert Aufmerksamkeit in die aufwändigen geistigen Aktivitäten, die dazu erforderlich sind. […] Die Operationen von System 2 gehen oft mit dem subjektiven Erleben von Handeln, Wahl und Konzentration einher.“
Kahneman beschrieb System 1 als den mühelosen Ursprung der bewussten Entscheidungen und Überzeugungen, zu denen dann System 2 gelangt. Es wird in gewissem Maß durch Dinge ausgebildet, die sich unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle abspielen. Es umfasst Fähigkeiten, mit denen wir geboren werden, aber durch unsere Erfahrungen kommen weitere hinzu. Wenn wir uns an Situationen gewöhnen, müssen wir nicht mehr System 2 aktivieren, um zu entscheiden, wie wir damit umgehen; man könnte sagen, sie werden einfach zum Repertoire von System 1 hinzugefügt, sodass sie künftig für schnelle Entscheidungen abrufbar sind.
Es könnte verlockend sein, System 1 als unsere emotionale Seite und System 2 als unsere logische Seite zu sehen, aber es wäre nicht richtig. Unsere Emotionen sind nicht auf das eine oder das andere System beschränkt. Sie können vielmehr beide Systeme aktivieren und von beiden aktiviert werden, ebenso wie unsere Voreingenommenheiten, Absichten und Handlungen. Es gibt auch nicht für jedes der Systeme eine spezifische Region im Gehirn, wo es seinen Sitz hat. Sie sind eher wie Programme, die uns beim Denken helfen. Das eine geschieht automatisch und das andere ist mit mehr Aufwand verbunden.
System 1 ist das Hintergrundprogramm. Es bietet laufend Vorschläge in Form von Eindrücken, Intuitionen, Impulsen, Absichten und Gefühlen. Wenn System 2 diese bestätigt, so Kahneman, „werden Eindrücke und Intuitionen zu Überzeugungen und Impulse zu bewusstem Handeln“. Das funktioniert meistens recht gut, und System 2 kann mit wenig Aufwand laufen. Aber alle Systeme sind anfällig für Voreingenommenheit, und so kann System 1 Fehler machen.
„Bedauerlicherweise […] können unsere ersten Eindrücke falsch sein. Sie können auf ungerechten und unrichtigen Stereotypen beruhen oder von Betrügern manipuliert sein. Und wenn sie einmal etabliert sind, kann es schwer sein, sie zu überdenken und zu ändern.“
Kahneman erklärt: „System 1 beantwortet manchmal einfachere Fragen als die, die ihm gestellt worden sind, und es versteht wenig von Logik und Statistik.“ Eine weitere Beschränkung, schreibt er, ist, dass man es nicht abschalten kann. Das macht uns anfällig für unerwartete Gemütserregungen, wenn wir mit Gedanken oder Situationen konfrontiert werden, die wir mit emotional aufgeladenen Erlebnissen assoziieren.
Mit anderen Worten, wir können emotional getriggert werden.
Um mit diesen Triggern umgehen zu können, müssen wir identifizieren, welche Gefühle wir empfinden und welche potenziellen Voreingenommenheiten sie unterstützen könnten. Empfinden wir Zorn? Angst? Bedauern? Haben wir das Gefühl, dass ein wichtiger Wert angegriffen worden ist? Ist es eine komplexe Kombination von Gefühlen, die uns nicht geheuer ist, weil wir sie nicht identifizieren können?
Es kann hilfreich sein, Emotionen nicht einfach als „positiv“ oder „negativ“ zu klassifizieren, sondern ein nuancierteres emotionales Vokabular zu entwickeln, damit wir genauer definieren können, was wir empfinden. Diese Fähigkeit, die sogenannte emotionale Granularität, hilft dabei, bessere Entscheidungen dafür zu treffen, wie wir reagieren. Statt z. B. ein Gefühl mit der Kategorie „zornig“ zu vereinfachen, könnten wir ein wenig tiefer schürfen und dann feststellen, dass wir tatsächlich frustriert sind, weil etwas nicht vorangeht, oder enttäuscht über ein Ergebnis, das wir nicht erwartet haben. Wir könnten tief betroffen wegen etwas sein, das wir als die Implikationen von etwas Gehörtem wahrnehmen, oder defensiv wegen unserer Position und unwillig, von etwas wegzugehen, das sich vertraut anfühlt.
Solange wir die Quelle unserer Reaktion nicht verstehen (ist der scheinbare Zorn in Wahrheit Frustration?), können wir nicht durchdacht mit der zugrunde liegenden Botschaft umgehen, die sie ausgelöst hat. Ob wir dieser Botschaft letztlich zustimmen oder nicht – unsere Überlegungen werden nicht sicher sein, wenn wir nicht in der Lage sind, zuerst das Gefühl zu identifizieren, das sie auslöst, und dann kritisch darüber nachzudenken, ob das uns zu einer vertretbaren Schlussfolgerung führt. Sollten wir z. B. Mitleid empfinden statt Zorn? Oder Neugier statt Verachtung? Diese wertvollen Informationen darüber zu besitzen, was wir empfinden und warum, ermöglicht oft die eigentliche Arbeit erst: die häufig schwere Aufgabe, aufrichtig zu hinterfragen, ob unsere Reaktion angemessen ist.
Vermeintliches Wissen loslassen
Da unsere erste Reaktion nicht immer angemessen ist und wir nicht immer bestätigen können, was diese erste Reaktion vorgibt, müssen wir bereit sein, unsere Standardpositionen zu überdenken und unsere Voreingenommenheiten zu überprüfen. Wir alle haben sie, was auch immer wir erlebt und gelernt haben – unser Gehirn ist mit ihnen verdrahtet, und sie dienen einem wichtigen Zweck. Allerdings merken wir es nicht immer, wenn sie aktiviert worden sind, und das kann ein Fallstrick sein, wenn wir uns nicht die Mühe machen, System 2 aufzurufen, unser bewussteres Denken. Der Moment, wachsam und vorsichtig zu sein, ist dann, wenn wir zum ersten Mal spüren, dass wir eine starke emotionale Reaktion auf bestimmte Wörter oder Gedanken verspüren, insbesondere wenn wir sicher sind, recht zu haben.
Für den Organisationspsychologen Adam Grant ist das Überdenken der ersten Reaktion so wichtig, dass er 2021 ein Buch darüber geschrieben hat. „Wenn man darüber nachdenkt, was erforderlich ist, um geistig fit zu sein, denkt man gewöhnlich als erstes an Intelligenz“, schreibt er in Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know. „Je intelligenter man ist, desto komplexer sind die Probleme, die man lösen kann – und desto schneller kann man sie lösen. Intelligenz wird herkömmlich als die Fähigkeit verstanden, zu denken und zu lernen. Doch es gibt eine andere Gruppe kognitiver Fähigkeiten, die in einer turbulenten Welt wichtiger sein könnte: die Fähigkeit, umzudenken und zu verlernen.“
„Gutes Urteilsvermögen hängt davon ab, die Fähigkeit zu haben – und den Willen –, sein Denken zu öffnen. Ich bin ziemlich sicher, dass Umdenken eine immer wichtigere Angewohnheit im Leben ist. Natürlich könnte ich mich irren. Wenn es so ist, werde ich mich beeilen, noch einmal nachzudenken.“
In elf Kapiteln und mit vielen Beispielen zeigt Grant, wie entscheidend diese Fähigkeit ist – und wie schwer für uns, zu akzeptieren, dass wir sie brauchen: „Wir zögern nicht nur, unsere Antworten zu überdenken. Wir zögern schon bei der Vorstellung, umzudenken.“
Um diese menschliche Tendenz zu illustrieren, verweist er auf die verbreitete Ansicht, es sei eine schlechte Idee, Antworten in einem Multiple-Choice-Test zu revidieren. Diese Ansicht ist so verbreitet, dass ein angesehenes Unternehmen, das Studenten auf Prüfungen vorbereitet, davor warnt, es zu tun, weil es wahrscheinlich dazu führe, eine richtige Antwort in eine falsche zu ändern. Infolgedessen, so Grant, glauben rund 75 % der Studenten, ihr erstes Bauchgefühl sei höchstwahrscheinlich immer richtig. Doch er fährt fort: „Als drei Psychologen 33 Studien einer umfassenden Analyse unterzogen, stellten sie fest, dass bei jeder Studie die Mehrheit der revidierten Antworten von Falsch zu Richtig geändert worden war.“ Vielleicht liegt das daran, dass Studenten ihre Antworten nur ändern, wenn sie sicher sind, dass die zweite Antwort stimmt. Dagegen wendet Grant ein: „Neue Studien deuten auf eine andere Erklärung hin – es ist nicht so sehr das Ändern der Antwort, das die Punktzahl verbessert, als vielmehr das Nachdenken darüber, ob man sie ändern sollte.“
Seltsamerweise blieben Studenten, die von diesem Irrtum erfuhren, unverändert abgeneigt dagegen, ihre Antworten zu revidieren.
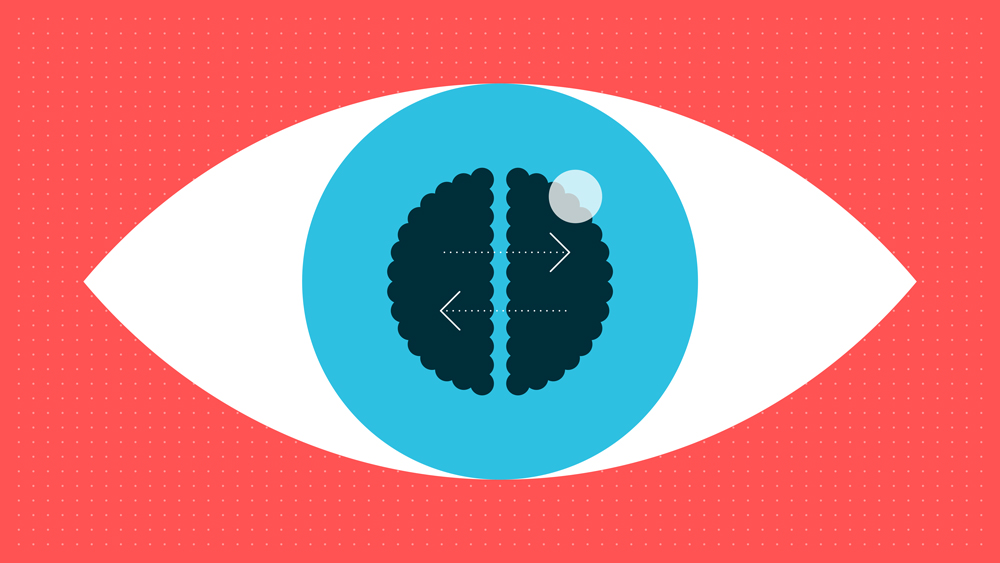
Die blinden Flecken im Denken
Unser Gehirn ist mit zahlreichen Voreingenommenheiten verdrahtet – automatischen Abkürzungen, die unsere Entscheidungsfindung beeinflussen können. Hier einige wichtige Voreingenommenheiten, die gutes Denken stören können:
- Bestätigungstendenz: unsere Tendenz, Informationen auszusuchen, die unsere bestehenden Überzeugungen bestätigen, und Belege, die ihnen widersprechen, abzutun
- Gruppenbezogene Voreingenommenheit: die Tendenz, Menschen zu bevorzugen, die wir als zu unserer Gruppe gehörig wahrnehmen
- Verfügbarkeitsfehler: Informationen, an die man sich leicht erinnert, werden als vorrangig eingestuft
- Erste-Instinkt-Falle: die Ansicht, unsere erste Reaktion sei gewöhnlich die beste oder richtigste
- Status-quo-Fehler: die Tendenz, Handlungen abzulehnen, die unsere aktuelle Situation verändern könnten
Dunning-Krueger-Effekt: die Tendenz, das eigene Wissen oder Können in einem bestimmten Bereich zu überschätzen
Es gehört Mut dazu, das eigene Denken zu hinterfragen, aber wir können uns fragen, was wir lernen könnten, wenn wir unser Unbehagen überwinden und es trotzdem tun. Natürlich könnten wir etwas lernen, das es nötig macht, etwas Neues in Betracht zu ziehen oder uns vielleicht sogar zwingt, anzuerkennen, dass etwas, das wir immer dachten, falsch war. Andererseits können wir tatsächlich Beweise finden, die unsere bisherigen Überzeugungen stützen, sodass ihre Grundlage stärker ist als zuvor. Wenn wir aber feststellen, dass einige unserer Ansichten auf unvollständigen oder unrichtigen Informationen beruhen, kann es nur zu unserem Besten sein, sie zu ändern, sodass sie wirklich unseren Werten entsprechen. An Ansichten festzuhalten, die nicht zusammenpassen, einfach weil der Gedanke an Veränderung unsere Trigger aktiviert, blockiert unser Potenzial, zu wachsen.
Gute Entscheidungsfindung verlangt uns die Demut ab, sowohl bezüglich der Tatsacheninformationen als auch der emotionalen Informationen, mit denen wir zu unseren Schlussfolgerungen kommen, intellektuell ehrlich zu sein. Sie verlangt uns ab, darüber nachzudenken, was wir denken und fühlen und warum wir es denken und fühlen, und flexibel genug zu sein, umzudenken, wenn die Tatsachen das erfordern.
„Bei meinen Forschungen über den Prozess des Umdenkens habe ich festgestellt, dass er oft kreisförmig abläuft. Er beginnt mit intellektueller Demut – dem Wissen, was wir nicht wissen.“
Der Forensikpsychologe Joe Pierre, Professor an der University of California in San Francisco, warnt: „Naiver Realismus – d. h. übergroßes Vertrauen in die eigenen subjektiven Intuitionen, Erfahrungen und Weltbilder – ist eine bedeutende kognitive Falle, die für uns alle die Gefahr birgt, uns zu fest an falsche Überzeugungen zu klammern und dabei stur darauf zu bestehen, recht zu haben.“ Allerdings kommen diese Überzeugungen nicht nur aus unserer eigenen subjektiven Erfahrung. „Vieles von dem, was wir glauben“, schreibt er, „beruht auf dem, was wir hören, lesen oder in anderer Form von anderen erfahren.“
Intellektuelle Demut verlangt uns die Einsicht ab, dass das, was wir sehen oder zu wissen meinen, nicht alles ist; es kann viel mehr geben, das wir nicht wahrnehmen. „Wahrnehmen und Denken geschehen in einer inneren Welt voller Voreingenommenheiten, Emotionen, Wünsche und anderer aktueller Belange des Moments“, schreiben der Psychologe Dennis Proffitt von der University of Virginia und der Journalist Drake Baer von Business Insider. „Es ist nicht so sehr du glaubst es, wenn du es siehst, sondern was du glaubst, bestimmt, was du siehst.“ Einige dieser Einflüsse auf unsere Wahrnehmung verlocken uns zu intellektueller Unehrlichkeit: die Antwort zu suchen, die wir haben wollen, statt die richtige Antwort zu suchen.
Proffitt und Baer schreiben: „Der Schlüssel zur Ausschaltung dieser Voreingenommenheiten ist zu erreichen, dass Menschen weniger automatisch denken“ – anders ausgedrückt: System 1 hinterfragen und System 2 einschalten.
Das Ziel ist nicht, emotionale Reaktionen zu eliminieren, um ausschließlich rational zu sein. Wie gesagt, Emotionen sind ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Entscheidungsfindung. Wir wollen vielmehr die Fähigkeit entwickeln, zu erkennen, ob Voreingenommenheiten oder Irrtümer gleich welcher Art unsere Emotionen oder unser Denken beeinflussen. Das Ziel ist, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie die beiden Formen des Urteilens zusammenwirken, um uns zu beeinflussen, und mit ihnen statt gegen sie zu arbeiten. Emotionale Intelligenz und analytisches Denken zu integrieren führt zu Entscheidungen, die unserem Wohl und unseren wahren Werten besser dienen – aber, so Grant: „Es gehört zuversichtliche Demut dazu, einzugestehen, dass wir noch in der Entwicklung sind. Es zeigt, dass es uns wichtiger ist, besser zu werden, als uns zu beweisen.“
Auf dieses Ziel hinzuarbeiten kommt nicht nur uns zugute, sondern auch allen Menschen um uns. Wenn wir den Mut aufbringen, unsere eigenen Voreingenommenheiten zu überprüfen, zusammen mit Demut und ehrlicher Neugier auf das, was andere tatsächlich meinen (stattdessen, von dem wir annehmen, dass sie es meinen), bauen wir stärkere Beziehungen auf. Dies ermöglicht uns wiederum, mit Situationen, die uns triggern, leichter zurechtzukommen und zusammen bessere Entscheidungen zu treffen, selbst unter emotional aufgeladenen Umständen.